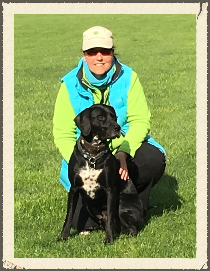Schokolade, Rosinen & Weintrauben
Schokolade enthält eine Substanz namens Theobromin die für Haustiere hochgiftig ist. Schon die Aufnahme geringer Mengen kann zu Vergiftungserscheinungen wie Magen-Darmkrämpfen, Erbrechen und Krämpfen, oder je nach Schokoladensorte sogar zu Todesfällen durch Herzrhythmusstörungen mit Herzstillstand führen. Besonders gefährlich - und das bereits in kleinen Mengen - sind Zartbitter und Blockschokolade, denn durch den höheren Kakaoanteil steigt auch die Menge des Theobromin.
Deshalb sollte Schokolade grundsätzlich und in jeglicher Form für alle Heimtiere tabu sein!
Der in vielen Haushalten beliebte Christstollen kann z.B. für Hunde zur letzten Mahlzeit werden. Oft sind nämlich Rosinen enthalten, die bei Hunden zu einem plötzlichen Nierenversagen und zu
Blutarmut durch Zerstörung der roten Blutkörperchen führen können.
Dasselbe gilt auch für Weintrauben, die oftmals sogar dem eigenen Hund zur Belohnung angeboten werden. Da die Dosis, die solche Vergiftungserscheinungen auslöst, nicht bekannt ist, sollten dem Hund
weder einzelne Weintrauben noch Rosinen gefüttert werden.
Quelle TINO/Ute Heberer
Zähne, Verdauung & Riechzellen
Hunde haben 20 Zähne im Oberkiefer und 22 Zähne im Unterkiefer, dass Milchgebiss hat oben und unten jeweils 14 Zähne.
Der Hund hat einen relativ kurzen Darm, 2,7 - 7% des Körpergewichtes (beim Mensch macht der Darm ca. 11% des Körpergewichtes aus), daher ist die Verdauung beim Hund empfinglicher als beim Mensch.
Die durchschnittliche Verdauungszeit beträgt beim Hund ca. 36Std. beim Mensch bis zu 3 Tagen. Daher neigt der Hund schneller zu Ducrhfall bei Störfaktoren.
Ein Hund hat ca. 1.700 Geschmacksknospen, der Mensch 9.000.
Ein Hund hat ca. 80-200 Millionen Riechzellen, der Mensch 2-10 Millionen
Warum Hunde so verschieden sind
Von Elaine A. Ostrander / Spiegel Online 21.07.08
Dogge, Greyhound, Chihuahua - kein anderes Haustier bildet derart unterschiedliche Rassen wie der Hund. Genetiker beginnen gerade zu verstehen, welche Erbanlagen - aber auch komplexen genetischen Mechanismen - hinter dieser Vielfalt stecken.
Ein Pekinese wiegt gerade ein paar Pfund, manch ein Bernhardiner bringt es auf 90 Kilo. So unähnlich beide aussehen - sie gehören trotzdem zur selben Art oder Biospezies. Nicht nur Hundefreunde und Züchter interessiert, wie die riesigen Unterschiede zwischen den vielen Rassen beim Haushund zu Stande kommen und wie es gleichzeitig sein kann, dass die Tiere einer Rasse einheitlich aussehen. Auch Säugetiergenetiker widmen sich in den letzten Jahren verstärkt solchen Fragen.
Hauptsächlich wollten die Forscher klären, welche Gene die diversen Krankheiten von Rassehunden mitverschulden, als sie Anfang der 1990er Jahre das "Hundegenomprojekt" ins Leben riefen. Zuchtverbände unterscheiden heute bis zu mehrere hundert Rassen. Die meisten davon existieren erst seit höchstens einigen Jahrhunderten. Oft sind sie in sich genetisch wenig vielfältig - zum einen, weil die Zucht einer neuen Rasse meist auf ganz wenigen, nah miteinander verwandten Tieren aufbaut, zum anderen, weil es nicht selten vorkommt, dass ein Typ plötzlich kaum noch gefragt ist und fast verschwindet, dann aber neuerlich Mode wird und aus einem ganz kleinen Genreservoir wieder auflebt. So erklärt sich, wieso besonders reinrassige Hunde vielfach an genetisch bedingten Krankheiten leiden. Die Genetiker versprechen sich von den Hundestudien aber auch Einsicht in eine Reihe von erblich bedingten Leiden, die ähnlich beim Menschen vorkommen - etwa bestimmte Arten von Krebs, manche Formen von Taubheit, Epilepsie, Diabetes, grauem Star oder bestimmte Herzleiden.
Hunde besitzen insgesamt 78 Chromosomen (der Mensch 46). Außer den beiden Geschlechtschromosomen (X und Y genannt) haben sie also 38 weitere Chromosomenpaare, die so genannten Autosomen. Nachdem die Forscher das Hundegenom mit seinen 2,4 Milliarden Basenpaaren zunächst grob kartiert hatten, gelang ihnen bald die Handhabe und Zuordnung auch einzelner großer DNA-Abschnitte. Bis zum Jahr 2003 hatten sie als Erstes knapp 80 Prozent der Erbsequenzen eines Pudels, eines Rüden, grob erfasst. Nicht lange danach konnten sie mit einer fast kompletten Sequenzierung des Genoms einer Boxerhündin aufwarten. Diese Sequenz dient heute als Referenzgenom des Hundes.
Die Möglichkeiten der Haustiergenetiker, erblichen Eigenschaften nachzuspüren, haben sich hierdurch tief greifend verfeinert. Wenn sie früher nach Erbhintergründen für eine Krankheit oder ein bestimmtes Merkmal suchten, setzten sie gewöhnlich bei bekannten Genen oder Genfamilien mit passenden Funktionen an. Manchmal kommt man so gut weiter, doch oft hat man viel Zeit und Geld umsonst eingebracht. Darum bedienen sich die Forscher heute zunehmend der raffinierteren Verfahren, die das Hundegenomprojekt eröffnet. Dank dessen können wir nun zum Beispiel leichter den genetischen Hintergrund von Zuchtrassen erfassen. Auch gewinnen wir neue Anhaltspunkte, welche körperlichen Merkmale wir zu Hilfe nehmen können, um nach kritischen Erbanlagen zu suchen. Entscheidend weitergekommen sind wir zudem in Fragen der Kartierung von Genen für die Körpergröße, Statur und Muskelmasse.
Dass die Haushunde von Wölfen abstammen, gilt heute als gesichert. Die ersten gab es vielleicht schon vor 40.000 Jahren. Ihre Domestikation könnte somit wesentlich früher als die anderer Haustiere begonnen haben, möglicherweise in Südostasien. Viele der heute beliebten Rassen entstanden allerdings erst im 19. Jahrhundert in Europa durch gezielte Zucht. Vereinzelt wissen wir zwar von ganz ähnlichen Tieren aus der Antike, doch ist unklar, ob etwa der Greyhound oder der Pharaonenhund, beides große Windhunde, tatsächlich auf jene uralten Formen zurückgehen oder nach antiken Vorbildern neu gezüchtet wurden.
Wann man von einer eigenen Hunderasse spricht, ist nicht einheitlich festgelegt. Des wegen schwankt die von verschiedenen Verbänden angegebene Anzahl. Die internationale Vereinigung für Kynologie, F. C. I. (der Dachverband für Zucht und Haltung von Hunden), hat weit über 300 Rassen registriert. Auch werden immer wieder neue anerkannt. Bei manchen Verbänden müssen zum Beispiel sowohl die Eltern als auch die Großeltern als reinrassig registriert sein. Wegen solcher strengen Regularien stellen viele heutige Rassen quasi geschlossene Populationen dar, in die von außen kaum neue Genvarianten - Allele - einfließen. Fast zwangsläufig sind Rassehunde darum genetisch meist weniger heterogen als Mischlinge. Diesen Effekt verstärkt der Mensch noch, wenn er etwa bevorzugt Tiere zur Weiterzucht verwendet, die in Wettbewerben gesiegt haben.
2. Teil: Wie man heute Gene aufspürt
Um Hunderassen genetisch zu definieren, also gegeneinander abzugrenzen, benutzen Forscher, auch mein Team, unter anderem so genannte genetische Marker. So bezeichnen wir Stellen - Positionen - im Genom, wo die DNA-Sequenz mehrere Varianten haben kann, also in verschiedenen Versionen auftritt, die nach den klassischen Vererbungsregeln weitergegeben werden. Zum Beispiel wiederholen sich bei so genannten Mikrosatellitenmarkern kurze Sequenzen in der DNA verschieden oft. Hingegen variiert bei SNPs (gesprochen "snips") ein einzelner Baustein, also ein einzelnes Nukleotid. Von der ersten Sorte kennen wir im Hundegenom Tausende, von der zweiten Millionen. Sie finden sich darin praktisch überall eingestreut. Ihnen benachbarte DNA-Abschnitte - auf die es uns ankommt, weil dort entscheidende Gene liegen könnten - vererben sich zusammen mit solchen Markern, also nach denselben klassischen Prinzipien.
Für unsere Studie standen uns 414 nicht näher miteinander verwandte Hunde aus insgesamt 85 Rassen zur Verfügung. Wir wählten 96 Mikrosatellitenmarker aus, die sich auf alle 38 Autosomen verteilen. Bei der statistischen Auswertung der umfangreichen Daten stellte sich he raus, dass allein hiermit jeweils jene Hunde tatsächlich eine eigene Gruppe bildeten, die wir einer eigenen Rasse zuordnen. Die wenigen Ausnahmen waren vor allem sechs Paare jeweils eng verwandter Rassen (wie Whippet und Greyhound oder Mastiff und Bullmastiff ). Sie zu unterscheiden gelang aber, als wir jeweils beider Daten isoliert von denen anderer Rassen betrachteten. Auch erwies sich die genetische Variationsbreite zwischen verschiedenen Rassen als wesentlich größer als die innerhalb von einzelnen Rassen. Zwischen ihnen erreicht die Variation schätzungsweise 27,5 Prozent. (Zwischen verschiedenen Bevölkerungen des Menschen beträgt sie nur 5,4 Prozent). Das bedeutet, dass es wirklich getrennte Hunderassen gibt. Sie unterscheiden sich nicht nur äußerlich, sondern ganz klar auch genetisch. Als wir anschließend mittels einer Blindstudie prüften, ob die einzelnen Tiere allein auf Grund ihres genetischen Profi ls vom Computer der richtigen Rasse zugeordnet würden, landeten 99 Prozent der Hunde tatsächlich bei der korrekten Gruppe.
Als Nächstes untersuchte meine Mitarbeiterin Heidi Parker mit denselben Daten die Verwandtschaftsbeziehungen dieser 85 Rassen, konstruierte also gewissermaßen einen Stammbaum. Ein Computerprogramm von Jonathan Pritchard und seinen Kollegen von der University of Chicago erkannte an der Häufigkeitsverteilung von Allelen mehrere genetisch unterschiedliche Gruppen oder Cluster. Man darf vermuten, dass diese Cluster jeweils Rassen umfassen, die näher zusammengehören, weil ihre Vorfahren demselben Genpool entstammten. Unsere Analyse lieferte vier große Cluster, sortierte also die 85 untersuchten Hunderassen in vier Gruppen - darunter eine für vermutlich sehr alte Linien: mit Hundetypen, bei denen ein asiatischer beziehungsweise afrikanischer Ursprung vermutet wird. Als weitere Rassen in die Studie einbezogen wurden, kristallisierten sich zusätzliche Gruppen heraus.
Diese Verwandtschaftsdaten helfen bei der Suche nach Genen für Krankheiten. Denn in manchen Fällen wird man leichter fündig, wenn man hierzu mehrere Rassen aus demselben Cluster zusammenwirft. Das kann nicht nur nützen, um eine verdächtige Region im Genom grob einzugrenzen, sondern erleichtert auch die Feinkartierung. Deren Ziel ist, mit gut definierten DNA-Abschnitten handhabbarer Größe von ungefähr einer Million Basen zu arbeiten, wenn man anschließend Genkandidaten auf Mutationen prüft. Als Forscher um Ewen Kirkness vom Institute for Genomic Research in Rockville (Maryland) im Jahr 2003 mit der Genomsequenz eines Pudels aufwarteten, hatten sie eine so genannte Übersichtssequenz erstellt. Sie hatten eineinhalb Durchläufe gefahren. Schätzungsweise sieben bis acht Durchgänge sind erforderlich, möchte man sichergehen, zumindest einmal möglichst alle der vielen tausend überlappenden Segmente zu erfassen, in die man ein Genom zum Sequenzieren zerlegt. Dieses Ziel erreichten im Jahr 2005 Kerstin Lindblad- Toh und ihre Kollegen vom Broad Institute in Cambridge (Massachusetts). Für den ersten Entwurf hatten sie das Genom einer Boxerhündin 7,5-mal gelesen. Die endgültige Version schließlich enthält davon fast 99 Prozent.
3. Teil: Gene mit störenden Einsprengseln
Beide Datensätze waren und sind für uns wertvoll. Die Übersichtssequenz von dem Pudel gab einen Eindruck, wie das Hundegenom aussieht, wie viele Gene es enthält und wie die Wiederholungselemente arrangiert sind. So überraschte, an wie vielen Stellen so genannte SINEs (kurze eingestreute Kernsequenzelemente) über das gesamte Genom verstreut auftauchen. Manche dieser Elemente befinden sich sogar an Positionen, wo sie sich auf die Genexpression auswirken können. Solch ein Element in dem Gen für den Rezeptor von Hypocretin (Orexin), einem Neuropeptidhormon im Hypothalamus, verschuldet beim Dober mann Narkolepsie, also anfallsartige Schlafattacken. Beim so genannten Merlefaktor sitzt ein SINE-Element in einem an der Pigmentierung beteiligten Gen. Fellpartien sind dann aufgehellt und gesprenkelt. Insbesondere Hunde, die den Faktor von beiden Eltern erhalten, haben oft schwere Sinnesschäden, sind zum Beispiel blind oder taub.
Die inzwischen vorliegende Sequenz vom Genom der Boxerhündin deckt dieses, wie gesagt, schätzungsweise zu 99 Prozent ab. Demnach scheinen Hunde rund 19.000 Gene zu besitzen. Drei Viertel davon ähneln hochgradig Genen des Menschen und der Maus. Im Hundegenom haben sich mehr als zwei Millionen SNPs angesammelt. Sie können als Anhaltspunkte dienen, um genetische Abweichungen - Varianten - innerhalb der Tiere einer Rasse wie auch zwischen verschiedenen Rassen aufzuspüren und deren Folgen festzumachen, gerade auch wenn es sich um komplex gesteuerte Merkmale handelt.
Forscher verwenden bei solchen Studien zum Beispiel umfangreiche DNA-Chips, mit denen sich Genome einzelner Tiere recht schnell gezielt durchsehen lassen. Für den Hund gibt es bereits Chips mit ungefähr 127.000 SNPs. Sie erlauben, mehrere tausend Stellen des Genoms gleichzeitig abzufragen. Wollen wir etwa den genetischen Hintergrund einer Krankheit ergründen, sagen wir von Lymphomen, müssen wir Genome kranker und gesunder Hunde vergleichen. Auf solche Weise können wir uns rasch an Abschnitte herantasten, auf denen daran beteiligte Gene zu liegen scheinen.
Seit einigen Jahren forschen mein Team und andere Gruppen nach Genen, die das typische Erscheinungsbild einer Hunderasse bestimmen, also etwa Körpergröße, Statur und Aussehen. Denn nicht nur die Größe eines Hundes, auch seine Proportionen, die Kopfform, Beinlänge relativ zum Rumpf und vieles mehr beruhen mindestens zum Teil auf genetischer Steuerung. Kein anderes Säugetier tritt so mannigfaltig in Erscheinung.
Die erste größere Untersuchung in diesem Bereich führten Gordon Lark und Kevin Chase von der University of Utah in Salt Lake City an Portugiesischen Wasserhunden durch, die sich früher Fischer für ihre Arbeit hielten. Diese Studien - Georgie-Projekt genannt nach einem Lieblingshund der Familie Lark - werden von den amerikanischen Züchtern und Haltern der Rasse unterstützt. Sie war im frühen 20. Jahrhundert fast ausgestorben, ließ sich dann aber noch retten. Die heutigen Tiere stammen von ganz wenigen Individuen ab, die meisten von zwei kleinen Zuchtgruppen, die Anfang der 1950er Jahre in die Vereinigten Staaten kamen. Trotz des kleinen Genpools und der Inzucht sind diese Hunde genetisch recht vielfältig, was sie als Objekt für solche Genstudien ideal geeignet macht (Bilder S. 53). Die Körpergröße etwa ist bei dieser Rasse längst nicht so streng eingegrenzt wie sonst oft. Den Züchtern ist vor allem wichtig, genetisch möglichst gesunde Tiere zu erhalten.
Inzwischen stehen den Forschern DANN-Proben von über 1000 Wasserhunden zur Verfügung. Mittels mehr als 500 Mikrosatellitenmarkern konnten sie bereits für fast die Hälfte der Tiere Übersichtsanalysen für das ganze Genom fertig stellen. Sie erfassten zudem Familien- und medizinische Daten. Auch machten sie pro Tier fünf Röntgenaufnahmen für Skelettmaße und -proportionen. So gewannen sie für fast 500 Hunde jeweils über 90 anatomische Messwerte, aus denen sie vier so genannte Hauptkomponenten - Sätze korrelierender Merkmale - errechneten, die den Skelettbau von Wasserhunden definieren.
Mit Hilfe dessen gelang es, im genetischen Material der Wasserhunde auf 22 Chromosomen 44 Genorte zu lokalisieren, die offenbar in einer Beziehung zu erblichen Skeletteigenschaften dieser Rasse stehen. Mit dem gewählten statistischen Verfahren erhält man Hinweise auf Stellen im Genom, die gemeinsam zu einem bestimmten Merkmal beitragen. Uns interessierte dabei besonders ein Ort (Locus) auf Chromosom 15, der eine starke Verbindung zur Körpergröße erkennen ließ.
Zwar deuteten die Analysen auf insgesamt sieben Orte im Genom hin, die bei der Größe anscheinend alle eine Rolle spielen. Doch wir wählten den Ort auf Chromosom 15 zum einen wegen des starken Zusammenhangs mit der Körpergröße und zum anderen, weil wir in seiner Nähe ein für das Merkmal verdächtiges Gen vermuten durften.
Um dieses Gen zu finden, suchten wir zunächst in einem DNA-Abschnitt von 15 Millionen Basenpaaren nach SNPs. Deren Muster bestimmten wir anschließend für alle Wasserhunde, deren Wuchshöhe wir in Erfahrung bringen konnten. Dabei stießen wir letztendlich auf eine Stelle nahe beim Gen für den Wachstumsfaktor IGF-1 (insulin-like growth factor 1, insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1). Dieses Gen beeinflusst bei Mäusen und auch beim Menschen die Körpergröße.
Wie wir erkannten, weist der fragliche Bereich mit dem Wachstumsfaktor-Gen bei den Wasserhunden zu 96 Prozent eine von zwei so genannten Haplotypen auf (worunter Genetiker verschiedene Versionen, Allelmuster, eines Abschnitts im Genom verstehen). Den mit relativ kleinem Wuchs assoziierten Haplotyp nennen wir B, den für großen Wuchs I. Portugiesische Wasserhunde mit zweimal dem Haplotyp B sind durchschnittlich am kleinsten, diejenigen mit zwei I-Haplotypen am größten. Dazwischen fallen Hunde, die beide Versionen besitzen.
Könnten Varianten an dieser Stelle auch allgemein die Körpergröße einer Hunderasse mitbestimmen? Wir prüften den fraglichen Abschnitt von Chromosom 15 bei 353 Tieren, wobei wir wiederum SNP-Marker zu Hilfe nahmen. Die Hunde stammten von 14 kleinwüchsigen und 9 sehr großen Rassen. Tatsächlich ergab der Vergleich Hinweise darauf, dass jenes Wachstumsfaktor-Gen für den Kleinwuchs einer Rasse verantwortlich ist. Insbesondere fi el uns auf, dass kleine Rassen davon oft auf beiden Chromosomen den gleichen Haplotyp tragen. Demnach dürften die Züchter, die immer kleinere Hunde wünschten, hier eine starke Selektion ausgeübt haben. Im Übrigen herrschte bei den kleinen Rassen unserer Studie, auch wenn sie miteinander nicht verwandt waren, ein einzigartiger Haplotyp vor, der bei den großen Rassen so gut wie nicht auftauchte. Die Mutation dürfte somit recht alt sein und reicht vermutlich weit in die Geschichte des Haushunds zurück.
Das Wasserhundprojekt lieferte eine Reihe anderer interessanter Genorte für Körperbaumerkmale, darunter solche, die anscheinend in Beziehung zur Kopfform, zur Körpergröße oder zur Beinlänge stehen. Daneben fanden die Forscher Stellen mit Genen, die vermutlich den Größenunterschied zwischen Rüden und Hündinnen bestimmen - ein typisches Merkmal der meisten Säugetiere. Genau ist nicht geklärt, wie dieser so genannte Geschlechtsdimorphismus bei Säugern generell zu Stande kommt. Wir wissen zwar, dass ein bestimmter Genort des Y-Chromosoms für die Ausbildung vom Geschlecht und der geschlechtstypischen Größe wichtig ist. Doch eindeutig kennen wir damit nur einen Teil der Faktoren.
4.Teil: Warum Rüden größer sind
Die Daten vom Portugiesischen Wasserhund halfen hier weiter. Zunächst zeigte sich, dass das Chromosom 15 einen Genort trägt, der im Wechselspiel mit anderen Genen steht und so die Männchen größer und die Weibchen kleiner werden lässt. Ob das erwähnte Wachstumsfaktor- Gen dahinter steckt, muss sich noch herausstellen.
Beim Portugiesischen Wasserhund sind die Hündinnen durchschnittlich um 15 Prozent kleiner als die Rüden. Bei den Hündinnen geht ein bestimmter Haplotyp jenes Bereichs mit geringer Größe einher, so erkannten Chase, Lark und ihre Kollegen. Ein anderer Haplotyp, also ein anderer Satz von Varianten, scheint bei Rüden zu bestimmen, dass sie eher groß werden. Dabei interagiert der Genort (Locus) auf dem Chromosom 15 mit einem Ort auf dem X-Chromosom, der auch bei zwei vorhandenen X-Chromosomen, also bei den Weibchen, nicht stillgelegt wird. Besitzt eine Hündin auf beiden X-Chromosomen den gleichen Haplotyp, und verfügt sie zudem auf Chromosom 15 zweimal über den Haplotyp für ein großes Körpermaß, dann erreicht sie durchschnittlich die Höhe eines stattlichen Rüden. Trägt die Hündin dagegen zwei verschiedene Versionen auf den Geschlechtschromosomen, bleibt sie klein, egal, wie Chromosom 15 ausgestattet ist. Wie soll man das erklären? Hilft dieser Befund verstehen, wie Gene im Wechselspiel miteinander auf komplexe Merkmale wie die Körpergröße einwirken? Zeigt er vielleicht sogar auf, wie dieser Geschlechtsdimorphismus in der Evolution entstand?
Eigenartig ist ja, wieso auf dem Chromosom 15 bei Männchen und Weibchen gegensätzliche Haplotypen vorherrschen. Chase und seine Kollegen postulieren einen weiteren genetischen Faktor - vielleicht auf demselben Locus auf Chromosom 15 wie das Wachstumsfaktor- Gen -, der dieses Gen bremst. Jener neue Faktor wäre geschlechtsspezifisch, nämlich nur dem "weiblichen" Haplotyp zugeordnet. Ein hypothetischer Haplotyp A, der nur das Wachstumsfaktor-Gen enthält, würde bei Rüden wie Weibchen für ein höheres Körpermaß sorgen. Der Haplotyp B würde das zusätzliche Gen tragen, welches ersteres Gen herunterreguliert und somit das Tier nicht so groß werden lässt.
Was hat das aber mit dem Genort auf dem X-Chromosom zu tun? Wieso entscheidet sich von dort her die Größe der Hündin? Vorstellbar wäre, dass das Gen auf dem Chromosom 15, das für mehr Wachstum sorgt, erst anspringen kann, wenn das X-Chromosom ein entsprechendes Signal liefert.
Die geschilderten Befunde passen zu einer These vom Anfang der 1980er Jahre. Demnach wurden die Säugetierweibchen nachträglich kleiner als die Männchen, als Selektionskräfte einen Größenunterschied der Geschlechter förderten. Nachträglich würden dadurch Mechanismen entstanden sein, die auf Wachstumsgene hemmend einwirken.
Nicht alle morphologischen Merkmale, die Hundegenetiker untersuchen, haben einen so komplexen genetischen Hintergrund. Denn manche Unterschiede im Körperbau lassen sich gut auf ein einzelnes Gen zurückführen. Im folgenden Beispiel, das wir untersucht haben, geht es um das Gen für Myostatin beim Whippet, einem beliebten kleinen englischen Windhund. Myostatin ist ein Protein aus dem Kreis der Wachstumsfaktoren, das den Aufbau von Muskelgewebe einschränkt. Whippets wiegen etwa neun Kilogramm und ähneln ansonsten dem größeren Greyhound. Normalerweise sind diese Tiere eher zierlich gebaut und ausgesprochen schlank und langgliedrig. Sie haben auch einen schmalen Kopf mit spitzer Schnauze und einen langen Hals. Doch manche Whippets sind bullige Muskelpakete (Bild unten), die mit ihrer breiten Brust, kräftigen Nackenpartie und den auffallend muskulösen Beinen überhaupt nicht ins Bild dieser Rasse passen. Die Züchter würden darum gern mit einem speziellen Gentest vorsorgen, damit möglichst wenige solche Tiere entstehen.
Wir stießen bei den Whippets auf eine neue Mutation im Myostatin-Gen, das hierdurch nur ein lädiertes Protein zu Stande bringt. Die bulligen Hunde tragen dieses mutierte Gen (Allel) auf beiden der zueinander gehörigen Chromosomen, haben davon also zwei Kopien und kein normales Gen. Einen Befund dieser Art hatten wir im Grunde erwartet, denn bekannt war bereits, dass auch bei Mäusen, Rindern und Schafen auffallend muskulöse Tiere heranwachsen, wenn das Myostatin- Gen defekt ist. Ähnliches ist sogar vom Menschen von ganz wenigen Fällen bekannt.
Interessanterweise besitzen auch Tiere mit einem defekten und einem normalen Gen für Myostatin durchschnittlich mehr Muskeln als ein klassischer Whippet, wenn sie auch bei Weitem nicht so bepackt daherkommen wie der bullige Typ. Ihr Brust- und Halsumfang ist etwas mächtiger, auch wiegen sie im Verhältnis zur Körperhöhe etwas mehr. Eine solche Mutation bedingt nach unserer Schätzung 60 Prozent der Variation beim Halsumfang und beim Verhältnis von Gewicht zu Größe sowie 31 Prozent der Variation bei den Brustmaßen eines Whippets.
Nun werden mit Whippets auch gern Rennen veranstaltet. Eignen sich dazu etwa Tiere mit einem normalen und einem mutierten Allel für Myostatin besonders gut? Sind diese im Durchschnitt womöglich schneller als die schlanken Exemplare? Und werden gerade sie deswegen bevorzugt in der Rennhundzucht eingesetzt? Falls ja, würden zwangsläufig immer wieder auch bullige Hunde geboren - sobald Mutter und Vater je ein schadhaftes Gen beisteuern. Unsere statistische Analyse bestätigte unseren Verdacht: Tiere mit einer Kopie des mutierten Gens fanden sich häufiger in der höchsten Klasse dieser Rennhunde als die mit zwei normalen Allelen.
Jeder zweite Whippet der A-Klasse trug die Mutation. Bemerkenswerterweise kam das defekte Gen am wenigsten bei Tieren vor, die nicht zu Rennen herangezogen werden, sondern allein auf Hundeschauen auftreten. Wir konnten auch zeigen, dass die A-Klasse-Hunde dieses Allel nicht allein deswegen so häufig aufweisen, weil die besten dieser Rennhunde am liebsten untereinander verpaart werden. Übrigens besitzen nach unseren Studien weder Greyhounds noch die muskulösen Mastiffrassen wie die Bulldogge diese Variante des Myostatin-Gens.
Das genetische Wissen über den Hund ist in den letzten drei Jahren beträchtlich angewachsen. Die Forscher haben sein Genom kartiert und sequenziert. Sie konnten bereits viele Genorte eingrenzen, die mit Krankheiten zusammenhängen. Vielfach fanden sie darin schon schuldige Mutationen. Allmählich sehen wir auch die Verwandtschaft der Hunderassen untereinander immer klarer.
5. Teil: Über den Hund hinaus
Dass einige grundlegende Erkenntnisse über den Aufbau - die Organisation - des Hundegenoms vorliegen, bewerten die Forscher als weiteren wichtigen Schritt. Zudem können sie sich inzwischen sogar an genetische Zusammenhänge bei komplex gesteuerten Merkmalen herantasten. Erste Einblicke, wie unterschiedliche Körpergrößen oder Wuchsformen zu Stande kommen, gelangen uns bereits. Selbst Hintergründe von manchen Verhaltensleistungen beginnen wir aufzuklären.
Für viele Krankheiten und Fehlentwicklungen mit erblichem Hintergrund erwarten wir, dass die Zahl kartierter dafür verantwortlicher Gene bald geradezu explosiv anwächst. Seit Langem versuchen Wissenschaftler herauszufinden, welche genetischen Fehler beim Hund an bestimmten Krebsarten oder Herzleiden, Hüftdysplasie, Seh- und Hördefekten beteiligt sind. Die neuen Analysemöglichkeiten erleichtern diese Arbeit wesentlich.
Somit könnten für Züchter bald Tests auf Gene für Krankheiten, die beim einzelnen Tier nicht durchbrechen, zur Verfügung stehen. Anhand der Ergebnisse ließen sich gesunde Tiere mit langer Lebenserwartung leichter gezielt erzeugen. Des Weiteren würden entsprechende Gentests eine Zucht zum Beispiel auf eine gewünschte Körpergröße oder Fellfarbe vereinfachen. Solche Tests werden sicherlich rasch verfügbar sein, sobald die Forscher die genetischen Hintergründe für ein bestimmtes Merkmal verstehen. Vielleicht werden Genetiker eines Tages sogar mentale Eigenschaften von Hunderassen erklären können - also etwa aufzeigen, wieso ein Vorstehhund das Wild nur anzeigt und davor erstarrt, und wieso ein Hütehund eine Schafherde zusammenhält.
Ob die Forscher jemals aufdecken werden, warum gerade der Hund zum besten Freund des Menschen wurde, bleibt off en. Vielleicht ist das auch gut so.